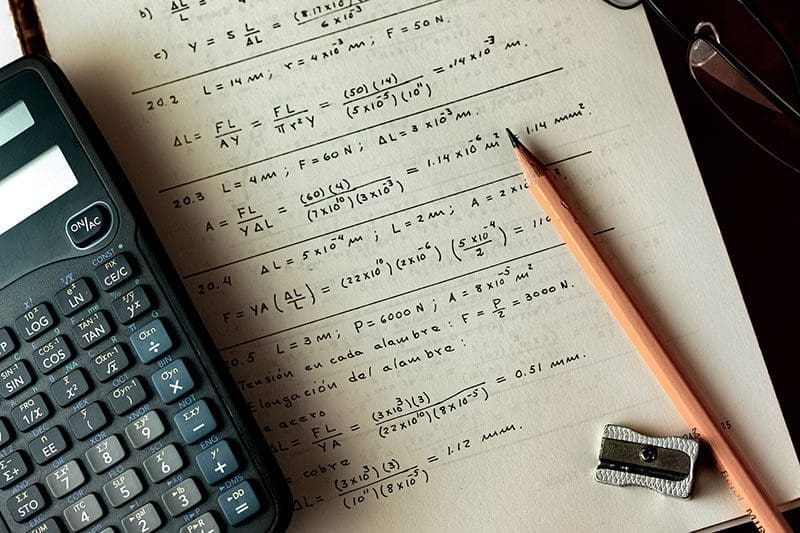Lernen und Gedächtnis: die Lernstrategien der Neuropsychologie


Einleitung: Erkenntnisse des Lernens
Die Hirnforschung hat in den letzten 20 bis 30 Jahren erhebliche Fortschritte in der Neuropsychologie gemacht. Viele hirnphysiologische Prozesse werden heutzutage viel besser und genauer verstanden, als noch vor wenigen Jahren. Auch im Bereich Lernen und Gedächtnis hat es viele neue Erkenntnisse gegeben. Aus einigen dieser Erkenntnisse leiten sich teilweise Tipps und Tricks für die tägliche Lernpraxis ab. Die wohl wichtigste Erkenntnis ist, dass es kein einheitliches Gedächtnis im Gehirn gibt. Stattdessen wird in der neueren Hirnforschung das Gedächtnis als ein Bündel von unterschiedlichen Hirnfunktionen aufgefasst, die auch in unterschiedlichen Hirnarealen lokalisiert sind. Während man in der Vergangenheit vorwiegend zwischen dem Kurzzeitgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis unterschieden hat, wobei es für beide Gedächtnisarten teilweise recht unterschiedliche Definitionen gegeben hatte, lassen sich nach der modernen Auffassung hauptsächlich vier Gedächtnisprozesse beschreiben: erstens das Arbeitsgedächtnis, zweitens das semantische oder Fakten-Gedächtnis, drittens das episodische oder autobiografische Gedächtnis und viertens das prozedurale Gedächtnis für Bewegungen, Gewohnheiten und Handlungsroutinen.

Die neuen Erkenntnisse in der Neuropsychologie zeigen mehr Tipps und Tricks zum Lernen für das Gedächtnis.
1. Ein Gedächtnis – oder besser: Die vielen Gedächtnisse
Subjektiv fühlt sich unser Gedächtnis meist wie eine Einheit an. Wenn wir etwas betrachten, darüber nachdenken oder gleichzeitig Handlungen ausführen, erleben wir uns als Individuum, also als ungeteiltes Wesen. Tatsächlich ist aber bei näherer Betrachtung die Gehirn- wie auch die Gedächtnisfunktion auf verschiedene Hirnareale verteilt, die teilweise sehr unterschiedlich arbeiten und daher auch ganz unterschiedlich bei Lernprozessen bedient werden sollten.
In der Vergangenheit waren die beiden häufigsten, eher metaphorisch als tatsächlich modellhaft, zu verstehenden Gedächtniserklärungen das Bild einer Tafel (als Schriftmetapher des Gedächtnis), zuerst dokumentiert bei dem großen Philosophen Platon und das Bild eines Magazins (als Raummetapher, in dem Gedächtnisinhalte aufbewahrt werden), welches zuerst bei den antiken Philosophen auftaucht, welche heute als Sophisten, manchmal auch als Rhetoriklehrer bezeichnet werden.
In der sogenannten „kognitiven Revolution“ in den 1960er und 1970er Jahren, wurde Denken, Lernen und Gedächtnis in Analogie zur Datenverarbeitung in einem Computer gesehen. Die Computermetapher betrachtet das Gehirn als Informationsverarbeitungsmaschine (Datenprozessor) und das Gedächtnis als einen Informationsspeicher.
Input erhalten Gehirn und Gedächtnis in Form von sensorischen Reizen und Wahrnehmungen, diese werden in das Zentralnervensystem (ZNS) geleitet und dort verarbeitet und gespeichert. Output erfolgt in Form von Bewegungen, die dann ausgeführt werden können. Auch Sprache und Sprechen sind letztlich motorische Programme. Denken kann mit Konrad Lorenz als „bewegen im Vorstellungsraum“ betrachtet werden.
Wie die tatsächliche Informationsverarbeitung im Gehirn erfolgt, wurde allerdings von Psychologen und Kognitionsforschern über viele Jahre ignoriert. Man betrachtete das Gehirn als Blackbox.
Mittlerweile werden mittels neuronaler Netzwerke zumindest Teile der Gehirnvorgänge nicht nur durch spezielle physiologische Untersuchungen untersucht, sondern auch mit entsprechenden neuronalen Netzwerken modellhaft an Computern simuliert. Auch wenn das Gehirn in vielen Teilen gerade nicht so arbeitet wie ein Computer, so gibt es etwa nicht die Trennung zwischen Software oder Hardware im Gehirn, ist das Computermodell aktuell die wohl geläufigste und beste Erklärungsmetapher und kann zumindest zahlreiche Gedächtnisvorgänge ansatzweise gut erklären.
In der Vergangenheit unterschied man vorwiegend zwischen dem Kurzzeitgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis. Aktuell wird das Kurzzeitgedächtnis nicht zeitlich, sondern funktionell definiert, nämlich als Arbeitsspeicher, in dem bewusste Denkprozesse, wie etwa das Kopfrechnen, stattfinden.
Das Langzeitgedächtnis wird nach moderner Auffassung bezüglich der Gedächtnisinhalte beschreiben: das Gedächtnis für Fakten (das semantische Gedächtnis), das episodische oder autobiografische Gedächtnis, in welchem Erlebnisse abgelegt werden, sowie das prozedurale Gedächtnis für Bewegungen, Gewohnheiten und Handlungsroutinen. Diese Gedächtnisse sollen im vorliegenden Artikel besprochen werden. Zahlreiche andere „Gedächtnisse“ wie das Iconische, das Sensorische, das Perceptive, das Quellengedächtnis oder das propositionelle Gedächtnis können aus Platzgründen keine Berücksichtigung finden.
2. Das Arbeitsgedächtnis
Das heute Arbeitsgedächtnis genannte informationsverarbeitende System wurde früher meist als Kurzzeitgedächtnis bezeichnet. Hier haben wir Gedächtnisinhalte, so etwa sprachliche Gedanken, in unserem Gedächtnisspeicher, die nur wenige Zeit in unserem Bewusstsein gespeichert werden. Während in der Vergangenheit geglaubt wurde, der Kurzzeitspeicher sei der notwendige Filter in den Langzeitspeicher, ist man heute der Auffassung, durchaus in Analogie zum working memory (Arbeitsspeicher) des Computers, dass im Arbeitsgedächtnis mentale Operationen stattfinden. So können wir etwa Kopfrechenaufgaben im Kurzzeitgedächtnis ausführen, Sätze formulieren, oder auch aktiv visuelle Bilder im mentalen Vorstellungsraum aktivieren. Die Speicherkapazität des menschlichen Arbeitsgedächtnisses ist abhängig von der kognitiven Domäne beziehungsweise den Inhalten die bearbeitet werden. Insgesamt ist das Arbeitsgedächtnis stark limitiert. Als Limit gilt bei vielen Menschen eine Anzahl von sieben Items plus minus zwei (nach dem Erstbeschreiber auch genannt als miller’s law). Genau genommen hatte Miller bereits schon gezeigt, dass eine Erinnerung für sieben Zahlen, sechs Buchstaben oder fünf Wörter möglich war, die Anzahl der speicherbaren Items Chunks also trial spezifisch ist.
3. Langzeitgedächtnis: explizites (deklaratives) Gedächtnis versus implizites (non-deklaratives) Gedächtnis
Auch das Langzeitgedächtnis wird von der modernen Hirnforschung anders betrachtet als in der Vergangenheit. Viele der neuen Erkenntnisse sind erstmals durch die Erforschung von unterschiedlichen Störungsmustern der Gedächtnisvorgänge bei verschiedenen Hirnerkrankungen entdeckt worden, wie weiter unten beschrieben wird.
Eine Grundunterteilung der Gedächtnisvorgänge lautet in deklaratives und prozedurales Gedächtnis, beziehungsweise explizites und implizites Gedächtnis. Als deklaratives beziehungsweise explizites Gedächtnis werden die Gedächtnisanteile bezeichnet, die uns bewusst zugänglich sind, an die wir uns bewusst erinnern können und über die wir dann auch sprachlich berichten können. Als implizites oder non-deklaratives Gedächtnis prozedurales Gedächtnis werden diejenigen Gedächtnisprozesse bezeichnet, deren Gedächtnisinhalte uns nicht bewusst und verbal zugänglich sind. Hierzu zählen zahlreiche sensorische und perzeptive Lern- und Gedächtnisfunktionen, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann. Wir werden nur den lern technisch wichtigeren Bereich des prozeduralen Lernens und Gedächtnis besprechen. Hier werden motorische Fähigkeiten und Gewohnheiten gelernt und gespeichert.
Das explizite (deklarative) Gedächtnis lässt sich in zwei Hauptgruppen unterteilen, erstens das semantische oder Fakten-Gedächtnis, und zweitens das episodische oder autobiografische Gedächtnis.
Während es subjektiv kein Unterschied ist, ob wir uns erinnern das London die Hauptstadt von England ist, oder ob wir letztes Jahr im Urlaub in London gewesen sind, ist es bezüglich der zugrunde liegenden Hirnvorgänge sehr wohl ein großer Unterschied. Aufgefallen ist dies den Hirnforschern bei verschiedenen Gehirnerkrankungen, bei denen beobachtet werden konnte, dass verschiedene Gehirnareale betroffen sind und dann entsprechend auch verschiedene Gedächtnisprozesse nicht mehr funktionieren. Die häufigste Erkrankung, die zu einer schweren Störung des Gedächtnisses führt, ist die Alzheimer-Erkrankung. Typischerweise ist am Anfang der Alzheimer-Erkrankung die Merkfähigkeit für erlebte Ereignisse und Episoden gestört. Betroffen ist also das sogenannte episodische oder autobiografische Gedächtnis. Menschen mit einer Alzheimer-Erkrankung können sich also nicht mehr daran erinnern, was sie heute Morgen zum Frühstück gegessen haben oder wen sie gestern zu Hause zu Besuch hatten. Das allgemeine Faktenwissen, also das semantische Gedächtnis, bleibt davon sehr lange unberührt. So bleibt bei Menschen mit Alzheimer Demenz das Faktenwissen, welches sie in der Vergangenheit erworben haben, wie auch ihre persönlichen autobiografischen Erinnerungen häufig noch bis ins mittelgradige Demenzstadium erhalten. Sie wissen also, dass London die Hauptstadt von England ist, oder dass die erste Mondlandung der USA im Jahre 1969 geschah, auch wenn sie nicht mehr wissen welchen Wochentag oder welche Jahreszahl vorliegt. Noch überraschender ist die Tatsache, dass Menschen mit einer mittelschweren Alzheimer-Erkrankung, die Klavier spielen können, häufig Beethoven Sonaten spielen können, von denen sie erstens nicht wissen, dass sie sie spielen können und zweitens nicht einmal wissen, wie sie heißen. Die motorischen Abläufe, die zum Spielen des Klaviers notwendig sind, sind von der Alzheimer-Erkrankung in der Regel nicht oder erst im aller spätesten Stadium betroffen. Dies liegt daran, dass die Bewegungsmuster für das Klavierspielen, wie auch zahlreiche andere Bewegungsmuster, in motorischen Arealen wie den Basalganglien im Gehirn abgelegt sind und nicht im zerebralen Kortex, wo ein Großteil des deklarativen Gedächtnisses abgespeichert ist. Die autobiografischen Gedächtnisanteile werden über den Hippocampus aufgenommen und dann im medialen Temporallappen gespeichert. Diese Areale sind im Rahmen der Alzheimer-Erkrankung meist frühzeitig betroffen, weswegen das entsprechende autobiografische Gedächtnis verloren geht.
Interessanterweise ist es nun nicht nur so, dass in der Vergangenheit gelernte Bewegungsmuster erhalten bleiben. Menschen mit einer Alzheimer-Erkrankung können auch noch neue Klavierstücke lernen, obwohl sie sich am nächsten Tag nicht daran erinnern können, dass sie die entsprechenden Klavierstücke eingeübt und dann auch erlernt haben.
Im Gegensatz zur Alzheimer-Erkrankung gibt es eine seltenere Demenzform mit dem Namen semantische Demenz. Hier ist zuerst das semantische Gedächtnis betroffen während autobiografische oder episodische Gedächtnisinhalte noch relativ lang erhalten bleiben und auch aktuelle Episoden des täglichen Lebens noch gelernt und erinnert werden. Auch das prozedurale Gedächtnis ist bei dieser Demenzform nicht gestört. Patienten mit der Erkrankung können, obwohl sie im Prinzip Sprache schon verstehen, bei vielen Sätzen die mit selteneren Konzepten einhergehen die Bedeutung nicht mehr erfassen. Das heißt, die Bedeutung von Begriffen geht langsam verloren, während andere Gedächtnisinhalte noch erhalten bleiben und auch noch erlernt werden können. Diese Demenzform ist bei den meisten Menschen in der Hirnregion des linken Schläfenlappens lokalisiert, dort wo die entsprechenden sprachlichen Felder für Begriffe, also für die Bedeutung von Wörtern abgespeichert sind.
Wie beim Beispiel der Alzheimer-Erkrankung schon erwähnt, ist ein großer Teil unseres prozeduralen Gedächtnisses für Bewegungen, Gewohnheiten und Handlungsroutinen nicht im Neokortex und nicht in medialen Kortex Arealen abgespeichert, sondern in den sogenannten Basalganglien und zum Teil auch im Kleinhirn. Dies hat zur Folge, dass Bewegungsmuster und Gewohnheiten ganz anders erlernt werden als bewusste Gedächtnisinhalte wie zum Beispiel die Tatsache, dass die Wallstreet in New York ist. Die bekannteste Erkrankung der Basalganglien ist das Parkinson-Syndrom. Bei dieser Krankheit sind entsprechend motorischen Funktionen gestört, wie auch das Erlernen neuer Gewohnheiten oder Handlungsroutinen.
4. Wissen: Theorie und Praxis des expliziten Lernens
Wer kennt ihn nicht, den schönen Spruch, dass man nicht alles wissen müsse, sondern nur wissen müsse, wo man es nachschlagen kann. Dies impliziert, dass Faktenwissen nicht besonders wichtig sei, da man ja insbesondere im Zeitalter von Wikipedia und Internet alles sowieso schnell nachschlagen kann. Bereits der griechische Philosoph Heraklit äußerte sich ähnlich: „Vielwisserei macht noch keinen klugen Kopf!“. Gerade in der modernen Didaktik und Pädagogik wird häufig betont, dass es wichtiger sei sogenannte Kompetenzen zu erwerben als basales Faktenwissen. Auswendig lernen gilt oft als stupide. Repetitives Üben als obsolet. Letztlich geht genau diese Unterscheidung auf die oben genannten Unterscheidungen zwischen dem expliziten Gedächtnis (Wissen) und dem impliziten Gedächtnis (Können/ Kompetenzen) zurück.
Tatsache ist aber auch, dass wir ohne ein gewisses Grundwissen an Fakten nicht auskommen. Ich bezeichne dieses Wissen gerne als Arbeitswissen (nicht zu verwechseln mit dem Arbeitsgedächtnis). Als notwendiges Arbeitswissen kann man dasjenige Wissen bezeichnen, das zum Beispiel zur Ausübung eines Berufes notwendig ist. Als Arzt kann ich nicht jeden medizinischen Fachbegriff irgendwo nachschlagen, denn damit würde ich viel zu viel Zeit verlieren. Ich muss also, je nach Tätigkeitsfeld, einen gewissen terminologischen Wortschatz parat haben. Ich kann auch nicht ständig die naturwissenschaftlichen Grundlagen meines Fachgebietes nachlesen, ebenso wenig die Krankheitsbilder. Denn wenn ich ein Krankheitsbild gar nicht kenne, kann ich es auch bei einem Patienten nicht erkennen oder vermuten. Wenn ich es nicht vermuten kann, weiß ich nicht, dass es infrage kommt, und dann kann ich es auch nicht in Wikipedia suchen, denn ich weiß ja gar nicht, dass es existiert. Das heißt, in vielen Berufen ist es weiterhin nicht nur sinnvoll, sondern sogar notwendig über ein solides Faktenwissen zu verfügen. Beim Erwerb von Faktenwissen lassen sich drei Säulen des expliziten Gedächtnisses festhalten:
Struktur
Die Struktur des dargebotenen Lernstoffes sollte anschaulich und klar erkennbar dargeboten werden. Dinge die wir nicht klar erkennen können, können wir auch nicht vernünftig registrieren und anschließend abspeichern. Anschauliche Fakten und konkrete Dinge sind für die meisten Menschen sehr viel einfacher erlernbar als abstrakte Begriffe. Ein anschauliches Beispiel ist für die meisten Menschen leichter zu verstehen, leichter zu lernen und besser zu behalten als eine abstrakte Regel. Um einen Rechenvorgang zu verstehen, hilft ein Rechenbeispiel den meisten Menschen sehr viel mehr, als das erklären einer mathematischen Regel oder das vorlegen eines mathematischen Beweises.
Dies ist auch ein Grund, warum sich so viele Sprichwörter im Sprachschatz erhalten haben. Hier ist Sprache in ihrer anschaulichsten Form verfügbar. Den Satz „Schuster bleib bei deinen Leisten“ verstehen viele Menschen, ohne dass sie groß darüber nachdenken müssen. Entsprechend können sie sich dieses Sprichwort auch gut merken.
Neben der Anschaulichkeit beziehungsweise Konkretheit als leicht lernbare Struktur, ist hier auch die Hierarchisierung zu nennen. Wenn ich einen unübersichtlichen Informationssalat zuerst ordne und strukturiere, ihn dann noch mit Ziffern hierarchisiert habe, kann ich ihn sehr viel besser erfassen und auch sehr viel besser abspeichern.
Aktivität
Eine weitere wichtige Säule des erfolgreichen Lernens ist die Unterscheidung zwischen aktiven Lernvorgängen und passiven Lernvorgängen. Vor 30 Jahren geisterten immer wieder Meldungen durch die Medien, dass man die Intelligenz und die Lernkapazität seines Babys dadurch verbessern könne, dass man während der Schwangerschaft das Kind mit Musik von Mozart berieseln würde. Dies stellte sich hinterher als völlig haltlos heraus. Es ließ sich niemals wissenschaftlich nachweisen, dass Kinder die während der Schwangerschaft klassische Musik gehört haben ein besseres Gedächtnis hätten, einen höheren IQ besitzen und auch nicht, dass sie musikalischer waren, als Kinder die keine klassische Musik während ihrer Schwangerschaft zugeführt bekamen.
Genau so ließ sich darstellen, dass Kinder denen im Kindesbett per Radio eine Fremdsprache vorgespielt wurde, durch diese Maßnahme in keiner Weise davon profitierten, die entsprechende Fremdsprache zu erlernen. Kinder, die jedoch aktiv im fremdsprachlichen Kommunikationsprozess mit ihrer Nanny waren, profitierten sehr wohl davon, wenn die Nanny eine Fremdsprache mit ihnen sprach. Das heißt für erfolgreiche Lernprozesse ist es häufig viel wirksamer, wenn aktiv gelernt wird, als wenn nur passiv berieselt wird. Das Gleiche kann man zum Beispiel bei vielen TV-Sendungen sehen. Die passive Berieselung im Fernsehen führt zu sehr viel weniger Verständnis und sehr viel schlechteren Lernleistungen von Inhalten als die aktive Auseinandersetzung mit einem Buch, in einem Unterrichtsgespräch oder auch mit einem interaktiven Lernprogramm am PC. Interessanterweise zeigt sich, dass die semantische Verarbeitungstiefe, die durch aktives Lernen erreicht wird, nicht nur dazu führt, dass wir Dinge besser verstehen, sondern quasi automatisch auch dazu führt, dass wir die entsprechenden Dinge viel besser behalten. Man kann hier also zusammenfassen, dass nicht die Absicht etwas bloß zu lernen und dann auf einfachem Wege zu behalten zu einer guten Gedächtnisleistung führt. Nein, stattdessen führt das verstehen Wollen und die dadurch ausgelöste intensivere Auseinandersetzung mit dem Lernstoff dazu, dass nicht nur die zu lernenden Dinge besser verstanden werden, sondern auch besser behalten werden. Dies gilt natürlich vor allem für das semantische Gedächtnis.
Übung
Bereits der Volksmund sagt „Übung macht den Meister“. Ein Sprichwort das wir auch bei den Briten kennen: „Practice makes perfect“. Bereits die alten Griechen hatten dies beobachtet: „Melete to pan“ (Alles ist Übung) ist bereits von den 7 Weisen des antiken Griechenlands überliefert.
Eine hinreichende Wiederholung von Lernprozessen ist für das Erlernen von Fakten häufig notwendig. Selten können wir uns ein Faktum oder gar mehrere Fakten in einem Text beim ersten Durchlesen vollständig merken. Je nach Komplexität des Lernstoffes und dem Abstand der Repetitionen benötigt es etwa 9-12 Wiederholungen, bis ein Großteil der zu lernenden Fakten auch tatsächlich behalten wird. Für das Lernen von semantischen Gedächtnisinhalten ist es dabei häufig von Vorteil, wenn genau das wiederholt geübt wird, was bereits gelernt wurde. Das heißt die Wiederholungen sind effektiver, wenn die Darbietung und auch der Inhalt der Fakten identisch sind, nicht nur ähnlich.
Dies kontrastiert interessanterweise zu vielen Übungsprozessen im Bereich des prozeduralen Lernens beziehungsweise beim Erlernen von Fertigkeiten und Können. In diesem Kontext ist es nämlich häufig von Vorteil nicht nur zu wiederholen, sondern die Wiederholungen auch leicht zu variieren. Dies kann man zum Beispiel beim Erlernen eines Musikinstrumentes schön darlegen. Wer immer nur dieselben Etüden auf dem Klavier oder exakt dieselben Rhythmen am Schlagzeug wiederholt, wird nicht in der Lage sein, diese musikalisch und flexibel im Kontext einer musikalischen Darbietung insbesondere im Kontext einer musikalischen Improvisation variabel anzuwenden. Wer aber einen Grundrhythmus am Schlagzeug mit wiederholten leichten Änderungen übt, wer diesen Rhythmus dann in verschiedenen Kontexten übt, und damit auch verschiedene Übergänge erwirbt, ist in seiner musikalischen Darbietung sehr viel flexibler. Analog kann man dies für viele Kompetenzen zeigen. Das Vortragen eines auswendig gelernten Gedichtes, bei dem im Lernprozess keine Variation stattgefunden hat, erlaubt keine freie Rede. Wer im Kontrast dazu frei Sprechen möchte, also etwa eine Rede frei halten will, muss genau das freie und variable Sprechen Üben. Ein wortwörtlich auswendig gelernter Vortrag muss dann genau so gehalten werden, da bei kleinen Abweichungen oft die Redestruktur verloren geht und der auswendig gelernte Text nicht mehr, zumindest nicht frei abgerufen werden kann.
Memotechnik oder „The Art of Memory”
Schon seit der Antike sind gewisse Gedächtnistechniken (Memotechniken) bekannt die im Rahmen von schulischem Lernen oder auch von sogenannten Gedächtniskünstlern verwendet werden. Je nach Lernprozess und Gedächtnisart, kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz. Dabei dienen alle diese kognitiven Strategien dem leichteren Lernen, dem besseren Behalten und dem vollständigeren Erinnern.
Die wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen ist eine ausreichende Motivation. Hierbei unterscheiden die Psychologen einerseits zwischen einer inneren sogenannten intrinsic Motivation und einer externen oder extrinsic Motivation. Eine intrinsische Motivation liegt dann vor, wenn eine Sache aus Freude an ihrer selbst gelernt wird. So zum Beispiel das Erlernen eines Musikinstrumentes, weil einem das Musizieren selber Spaß und Freude bereitet. Externe Motivation würde vorliegen, wenn man ein Musikinstrument erlernt, um damit seinen Freunden oder seinen Eltern zu gefallen oder um damit Geld zu verdienen. Echte Höchstleistungen werden meist nur von intrinsisch motivierten Menschen erbracht.
Der nächste Schritt bei einem Lernprozess ist die Aufmerksamkeit oder Konzentration. Hiermit sind letztlich drei verschiedene Prozesse genannt. Der erste ist die Orientierung oder Hinwendung zu einem Reiz oder zu einer Tätigkeit, in diesem Fall zu einem Lernprozess. Zweitens ist die Fokussierung auf das was getan wird und unter drittens die Ausblendung (Filterung) von anderen Dingen, die von dem Lernprozess ablenken können. Ohne eine gewisse Motivation, ohne die Fähigkeit sich selbst zu begeistern, werden häufig komplexe und länger dauernde Lernvorgänge nicht erfolgreich bewältigt. In diesem Sinne kann man sagen «Enthusiasm is a key factor for success».
Um eine Fokussierung oder Konzentration auf einen Lernvorgang aufrechtzuerhalten müssen Ablenkungsfaktoren ausgeschaltet werden, da viele Menschen nicht in der Lage sind, konkurrierenden Vorgängen keine Aufmerksamkeit zu widmen. In diesem Sinne ist es besser an einem ruhigen Ort zu lernen als in einem Kaffee oder einem Restaurant. Der zweite allgemeine Faktor, der festgemacht werden kann, sind Lernpausen. Wir wissen, dass Lernvorgänge auch passive Ruhephasen benötigen, von daher sollten Lernvorgänge immer mit entsprechenden Pausen unterbrochen werden, damit die Lernstoffe verdaut werden können (siehe auch unter Inkubationsfakt). Konkret heißt das, dass man nicht länger als 1.5 bis 2 Stunden, maximal 2.5 Stunden im Stück lernen sollte. Danach sollte eine Pause eingelegt werden, in der man zum Beispiel Tee oder Kaffee trinkt oder an die frische Luft geht. Es sollten in der Pause keine anderen Lernvorgänge, die mit dem gelernten interferieren könnten, durchgeführt werden, da dies die Lernleistung erheblich verschlechtern kann. So wäre es keine gute Idee nach zwei Stunden das erlernen von Englisch Vokabeln, statt einer Pause mit einem Spaziergang, eine Stunde mit Lernen von Französischen Vokabeln zu verbringen. Letzteres würde die Lernleistung der Englischen Vokabeln deutlich verschlechtern, weil in diesen semantisch ähnlichen Gebieten von einer deutlichen Interferenz der Merkvorgänge auszugehen ist. Wenn man jedoch nach dem Erlernen von Englischen Vokabeln eine motorische Übung macht, zum Beispiel ein Kunststück mit dem Fahrrad erlernt oder ein Klavierstück spielt, also etwas deutlich unterschiedliches macht, kommt es zu keiner wesentlichen Interferenz.
Die bekanntesten Lernhilfen sind sogenannte Eselsbrücken. Hierbei werden einfache Tatsachen in Merk Reimen, also in Versform gebracht, sodass sie besser memoriert werden können. Ein bekanntes Beispiel aus der Geschichte ist: «333 bei Issos Keilerei». Im Jahre 333 vor Christus besiegte Alexander der Große die Perser in einer monumentalen Schlacht. Dieser Merk Reim ist schon von zahlreichen Schülergenerationen gelernt worden, und hat die Merkleistung für dieses Ereignis sicherlich enorm gesteigert. Sich eigene Merkreime zu bilden ist also eine sehr erfolgreiche Lernstrategie.
Spektakulär sind manche Gedächtniskünstler mit der sogenannten «Methode der Orte» geworden, auch dies ist eine Memotechnik, die seit der Antike bekannt ist und häufig von Rhetoriklehrern vermittelt worden ist. Hierbei gestaltet sich der Lernende ein Haus oder einen Tempel mit mehreren Räumen, die er für sich festlegt. In diesen Räumen werden dann zu lernende Gedächtnisinhalte abgelegt. Analog kann dies auch mit einem visuellen Lernbild erfolgen, auf dem man sich 20 Items selber zurechtlegt, die dann jeweils mit einem zu lernenden Gegenstand assoziiert werden. Dies kann zum Beispiel angewendet werden, wenn man einkaufen geht und erspart das Erstellen eines Einkaufszettels. Erfahrene und professionelle Gedächtniskünstler erreichen mit diesen beiden Methoden teilweise sehr beeindruckende Steigerungen ihrer Gedächtnisleistungen.
Eine weitere Methode ist die sogenannte «PQ4R-Methode». Hierbei handelt es sich um eine Lese- und Lernstrategie, die zu einem langsamen und gründlichen Lesen führen soll, bei der die semantische Verarbeitungstiefe gesteigert wird, wodurch einerseits das Verständnis und andererseits das Lernen und Behalten verbessert wird. Bei dieser Methode verschafft man sich zunächst einen Überblick über den Lernstoff, also meist den zu lesenden Text oder das zu lesende Buch, dann stellt man sich hierzu Fragen, die einen an diesem Thema interessieren und die der Text beantworten soll. Dann liest man den Text und reflektiert über das eben gelesene. Anschließend versucht man den Inhalt zusammenzufassen und in eigenen Worten wiederzugeben. Zum Schluss blickt man auf den gesamten Lernvorgang noch einmal gesamthaft zurück. Die «PQ4R» Methode hat sich bei vielen Lernprozessen sehr bewährt. Hier noch einmal sämtliche Arbeitsschritte:
- P steht für Preview = Vorschau, also den Überblick,
Q steht für Questions = Fragen an den Text oder den Autor,
R steht für Read = Lesen, hier für aufmerksames Lesen, ggf. auch mit anstreichen von wichtigen Passagen oder dem Excerpieren von wichtigen Ideen und Gedanken,
R steht für Reflect = Nachdenken, im wahrsten Sinne des Wortes,
R steht Recite = Wiedergeben, am besten in eigenen Worten,
R steht für Review = Rückblick.
Natürlich kann man auch den ein oder anderen Lernschritt überspringen.
Obwohl es viele Möglichkeiten gibt das Lernen spezifisch zu verbessern, bleibt festzuhalten, dass es keine allgemeine Methode gibt, die auf alle Lernvorgänge anwendbar wäre und in allen Lernbereichen eine Verbesserung erzielt. Der Lernstoff ist immer materialspezifisch zu bearbeiten. Das heißt, wenn ich motiviert bin beim Fach Mathematik, weil es mir Spaß bringt oder ich einen netten Lehrer habe, führt das nicht zwangsläufig zu einer Motivation im Fach Deutsch oder Geschichte.
Auch ist es so, dass Übungsvorgänge in einem Bereich häufig nicht in andere kognitive Bereiche transferieren. So gibt es beeindruckende Experimente, bei denen die Probanden ihre Gedächtnisleistungen für Buchstaben in sehr beeindruckender Weise steigern konnten. Dies transferierte jedoch nicht einmal in den Bereich für Zahlen.
Selbst in einem domänenspezifischen Bereich transferieren Übungsvorgänge nicht immer selbstverständlich. So führt zwar das Erlernen einer Beethoven Sonate 1 dazu, dass man etwas besser allgemein am Klavier spielen kann. Es führt allerdings nicht automatisch dazu, dass man auch die Sonate 2 oder Sonate 3 ebenfalls spielen kann. Stattdessen muss man in der Regel mühsam alle entsprechenden Sonaten durchspielen und je nach dem Fähigkeitsniveau sich teilweise auch mühsam erarbeiten. So sehr also gewisse Lerntechniken einerseits das Lernen erleichtern und die Gedächtnisleistung verbessern können, so wenig gibt es eine alles Selig machende Methode, beziehungsweise einen Königsweg. Verschiedene Lernstrategien sind in verschiedenen Bereichen überlegen. Der Satz «There is no royal road to mathematics» gilt auch für andere Lernfelder.
5. Können: Theorie und Praxis des impliziten Lernens
Während man episodische Erlebnisse häufig dadurch gut behält, dass sie einen emotional angesprochen haben und semantische Gedächtnisinhalte dadurch gut erlernt, dass man die primären Fakten gut erkennt und sich vor allem um ein grundlegendes Verständnis bemüht, ist es beim impliziten Lernen häufig genau umgekehrt. Hier heißt der Wahlspruch: „Nachmachen nicht nachdenken“.
Viele Bewegungsabläufe, etwa der Umgang mit einem Werkzeug wie einem Küchenmesser oder auch beim Erlernen eines Musikinstruments, erlernen wir am einfachsten dadurch, dass wir bei einer anderen Person diese Vorgänge imitieren, also nachmachen. Das „Lernen am Modell“ wurde in den 70er Jahren vor allem von Professor Bandura als wichtiger Lernprozess betont. Natürlich sind Imitationsprozesse als Lernvorgänge schon seit hunderten von Jahren den Philosophen und Psychologen bekannt. Interessanterweise wurde das Lernen am Modell oder das Lernen durch Imitation in 80er und 90er Jahren fast vollständig aus den Lehrbüchern der Psychologie verbannt. Der Grund dafür war, dass man für diesen komplexen Lernvorgang überhaupt keine hirnphysiologischen Modelle und auch keine Analogie am Computer hatte. Als dann Anfang der 1980er Jahre, zuerst beim Affen, später auch beim Menschen, die sogenannten Spiegel-Neurone entdeckt wurden, explodierte nun wieder die Literatur über emphatische Kommunikation und auch über Lernen durch Imitation. Dieses ist sowohl beim motorischen Lernen, aber auch bei sozialen Handlungen ein sehr wichtiger Lernprozess.
Dass bei der Imitation das verstehen Wollen häufig hinderlich ist, lässt sich in zahlreichen Beispielen zeigen. Wer zum Beispiel einen Tennisaufschlag machen will und dabei überlegt, welche Muskeln er vielleicht anspannen soll und in welcher Reihenfolge er den Ball wirft, den Arm mit dem Schläger dann hochhebt und wie die Schlagbewegung in den verschiedenen Armgelenken gleichzeitig geschieht, wird meistens erfolglos bleiben.
Eine einfache Begründung dafür liegt darin, dass unser Bewusstsein notorisch langsam arbeitet, die motorisch zu erlernenden Prozesse aber sehr schnell sind. Das bedeutet also, dass wir diese motorischen Prozesse nicht aktiv durch unser bewusstes Supervidieren kontrollieren können. Stattdessen ist es oft zielführender, wenn man dem Tennislehrer zuschaut, wie er mit der linken Hand den Ball hochwirft um mit der rechten Hand und dem Schläger den Ball über das Netz zu schlagen. Auch hier gilt natürlich, dass Übung den Meister macht und diese Vorgänge dann sehr häufig gelernt werden müssen, beziehungsweise über lernt werden müssen.
Erst dann ergibt sich die notwendige Sicherheit in der Ausführung. Dies gilt für fast alle motorischen Vorgänge, inklusive komplexer motorischer Vorgänge wie dem Halten eines Vortrages. Auch hier ist es für die Ausführung und den Erfolg häufig sehr nützlich, wenn der Vortragende den Vortrag oder überhaupt das Vortragen, häufig geübt hat. Dies steht zum Teil im Kontrast mit gewissen modischen pädagogischen Bewegungen, die meinen, man bräuchte die Dinge nicht allzu sehr üben, da man ja alles nachlesen und nachschlagen kann. Im Bereich des Kompetenzerwerbens ist Übung jedoch die zentrale Säule des Erlernens.
Interessanterweise gibt es auch Lernsituationen, bei denen eine erhöhte Übungsfrequenz oft gerade nicht zum Erfolg führt. Teilweise brauchen Lernvorgänge, insbesondere auch komplexe prozedurale Lernvorgänge genügend Zeit, damit das Gelernte bildhaft gesprochen „verdaut“ werden kann. In der Psychologie sprechen wir dann in Analogie zu Infektionsvorgängen, die Zeit benötigen, von einer „Inkubation“. Diesen Begriff benutzen wir, da weder von Außen noch von Innen betrachtet während dieser Inkubation etwas passiert. Nichtsdestotrotz finden anscheinend unbewusste Verarbeitungs- und Lernprozesse statt, auch während wir nicht aktiv etwas tun. Dies ist schon lange beim Erlernen von Musikinstrumenten bekannt. Bei spieltechnisch sehr anspruchsvollen Musikstücken ist es nicht selten hilfreich, wenn man in einem Übungsprozess nicht weiterkommt, die Übungsvorgänge für genau dieses Stück eine Zeit lang, zum Beispiel ein bis vier Wochen, ruhen zu lassen. Häufig ist dann im Anschluss das Spielen genau dieses Musikstückes auf einmal wie von Wunderhand möglich, obwohl man zwischenzeitlich dieses gerade nicht geübt hat. Welche hirnphysiologischen Vorgänge genau im Hintergrund geschehen, um dies zu ermöglichen, ist weiterhin unbekannt.
Eunuchen-Intelligenz: Man weiß wie es geht, aber man kann es nicht
Bereits weiter oben haben wir auf den Unterschied zwischen Wissen und Können im Sinne des expliziten und impliziten Gedächtnisses hingewiesen. Dabei ist es nicht nur so, dass zwischen Wissen und Können unterschieden werden kann, sondern dass häufig beim reinen Faktenlernen nicht mitgelernt wird, wie das Wissen dann auch angewendet werden kann. Letztlich ist nämlich das Anwenden von Wissen ein prozeduraler Vorgang, muss oft zusätzlich erlernt werden, und wird in anderen Hirnarealen abgespeichert als die gelernten Fakten. Dies ist auch der Grund, weswegen sich häufig beim Erlernen von Wissen, die Fähigkeit dieses anzuwenden sich nicht von alleine ergibt. Dies wird in vielen didaktischen Situationen leider vergessen.
Als Beispiel mag das Erlernen einer Fremdsprache gelten. Die Sprache lässt sich schön als ein System aus Wörtern und Regeln beschreiben. Hier zeigt sich dann, dass beide Systeme, nämlich das Wissen-System und das Können-System zusammenwirken müssen, um komplexe kognitive Inhalte erfolgreich zu erlernen und zu meistern. Die einzelnen Wörter erlernen wir als Vokabeln, welche im mentalen Lexikon abgespeichert werden (Semantisches Gedächtnis) und gesamthaft den erlernten Wortschatz ergeben, gespeichert im linkscerebralen Temporallappen. Die Aussprache der Vokabeln benötigt unsere motorische Kompetenz (phonetisch/ phonematisches System), gespeichert im motorischen Kortex und den Basalganglien.
Im Regelbereich lernen wir, wie die Wörter im Gebrauch dekliniert (Substantive) oder konjugiert (Verben) werden und wie die Wörter im Satz verwendet werden (Syntax, einerseits als Wissen der Grammatik, andererseits als verwenden Können als Teil des prozeduralen Gedächtnis).
Wir haben hier also ein schönes Beispiel wie das Wissen-System (Vokabeln/ Semantik) und das Können-System (Regeln/ Grammatik) zusammenwirken. Entsprechend hat man beim Sprachen Lernen auch festgestellt, dass das separate auswendig Lernen von Vokabeln und das davon abgetrennte Erlernen von grammatikalischen Regeln häufig nicht besonders erfolgreich ist. Man kennt nun die Regel, aber man kann sie nicht anwenden, entsprechend dem Konzept der Eunuchenintelligenz. Besser ist es, wenn man ein Basisvokabular erlernt, aber gleichzeitig auch schon durch das Erlernen von Phrasen und Idiomen die Anwendung oder Verwendung des Wortes im Kontext mitlernt. Genau so ist es häufig erfolgreicher sprachliche Satzgebilde anhand von Beispielen zu erlernen und zu verwenden, anstatt nur die abstrakten grammatikalischen Regeln die dahinterstehen. In diesem Sinne gilt, Sprache lernt man nur durch Sprechen, so wie man Schwimmen nur im Wasser lernt. Das ewige Durchführen von Trockenschwimmübungen an Land oder auf einem Stuhl führt selten zu nachhaltigem Erfolg.
Exkurs: Über Gewohnheiten
In der Medienwelt werden Gewohnheiten oft mit Rigidität gleichgesetzt und das spontane Verhalten aus dem Jetzt heraus als positiv oder überlegen dargestellt. Dies ist häufig eine sehr oberflächliche Betrachtung des tatsächlichen Sachverhaltes. Routine ist nicht gleich Rigidität. Im Gegenteil, Gewohnheiten (Routinen, bewährte Handlungsschemata, Handlungsalgorithmen) verringern die für eine Aufgabe benötigte Aufmerksamkeit und mentale Kapazität. So ermöglichen uns Gewohnheiten überhaupt erst geistige Freiheit, also das Nachdenken. Hätten wir nicht die Gewohnheit erlernt von der Bushaltestelle nach Hause zu gehen, könnten wir auf dem Nachhauseweg gar nicht darüber nachdenken, was wir zu Mittag kochen wollen oder was wir heute Nachmittag unternehmen möchten. Wir müssten während des Gehens unsere Aufmerksamkeitskapazität kontinuierlich auf die Wegstrecke lenken, damit wir uns nicht verlaufen oder sonst etwas Unangenehmes geschieht. Kapazität zum Nachdenken oder Planen hätten wir dann nicht.
Routinen erhöhen generell die Handlungssicherheit und verringern damit die Fehlerquote. Das heißt, ohne Routinen sind wir viel langsamer und unsicherer in unseren Handlungen und machen entsprechend viel mehr Fehler. Das Spielen eines Musikinstrumentes oder eine vergleichbare prozedurale Tätigkeit ist ohne Übung und ohne Handlungsroutinen völlig undenkbar.
Das beste Beispiel ist das Erlernen des Autofahrens. Am Anfang ist man völlig überfordert mit Händen und Füßen verschiedene Funktionen zu erlernen: Lenkrad, Schaltknüppel, Kupplung, Gas, Bremse, dann auch noch auf den Verkehr achten, nicht nur vorne, sondern auch im Rückspiegel. Es benötigt die volle Aufmerksamkeit und geht alles sehr ruckelig und langsam. Es ist nicht daran zu denken, gleichzeitig noch das Radio zu bedienen oder zu telefonieren. Sobald aber die Abläufe automatisiert sind, kann man mit den Mitfahrern diskutieren und zahlreiche andere Dinge parallel während des Autofahrens erledigen. Dies ist auch die Erklärung des Multitasking. Niemand kann gleichzeitig Dinge ausführen die bereits einzeln seiner Aufmerksamkeit bedürfen. Sobald aber die Abläufe aber automatisiert worden sind, also als Handlungsroutine abgespeichert wurden, verfügt der Mensch wieder über freie mentale Kapazität, um gleichzeitig etwas Zusätzliches zu erledigen.
Kritik wird an Routinen erst sinnvoll, wenn sie dort angewendet werden, wo sie nicht am Platz sind. Hier kann man dann tatsächlich von Rigidität sprechen, die einen Mangel an mentaler Flexibilität hervorruft und kontraproduktiv ist. Der Satz: «Dies haben wir eben immer so gemacht», ist insofern häufig tatsächlich ein Ausdruck von mangelnder geistiger Flexibilität und nicht von souveräner Beherrschung von Handlungsroutinen. Denn diese können wir zum Glück ändern wenn wir wollen.
Über den Autor
Dr. Ralf Siedenberg wurde in Hamburg geboren und wuchs dort auf. Er studierte Medizin, Philosophie, Psychologie, Geschichte und Ökonomie an den Universitäten Hamburg, Edinburgh und London. Anschließend lebte und arbeitete er in England, Schottland, den USA, Deutschland und aktuell in der Schweiz. Er ist Facharzt für Neurologie und leitet das Neurologicum Zürichsee.
Kontakt und weitere Informationen: www.neurologicum.ch
Bildquellen:
Pixabay | Porträtbild des Autors: © www.neurologicum.ch